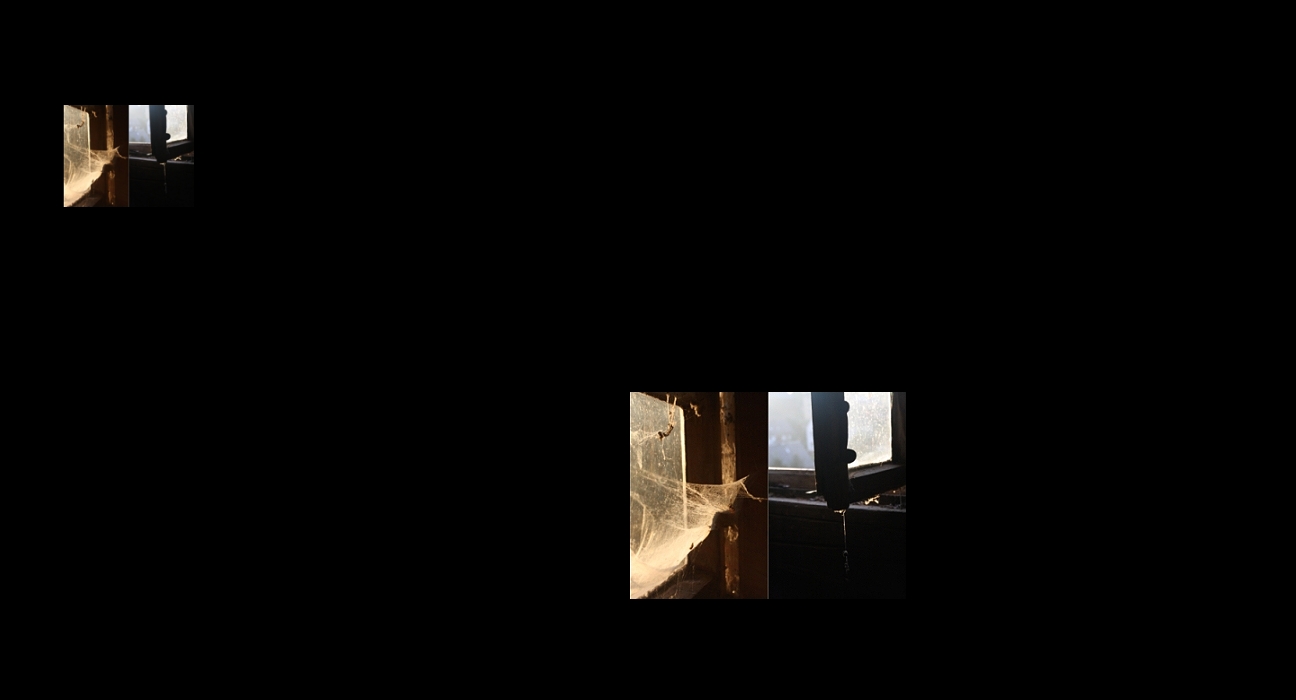| Wie der Weber seinen Faden verlor Es hatte geregnet, fast durchwegs, und der kalte Herbsttag begann grau und früh, mit neuen Nachrichten über Truppenbewegungen. Hier in Lößnig, fast eine komplette Fußstunde südlich vor Leipzig, begann der Tag eigentlich besonders ruhig. Johann Athanasius Anton Weber hatte überaus großen Respekt vor der Stille und verehrte die Ruhe wie einen heiligen Zustand. Er hatte es eigentlich schon geschafft sein bescheidenes Leben vor fast allem zu verstecken. Nun aber kam Napoleon. Der wiederum wurde verfolgt von der Großallianz zur „Befreiung Europas“. Der im Russlandfeldzug abgestürzte Empörer Europas, stolperte zur Neuformierung nach Leipzig. Nach dem langen Todeslauf durch das russische Winterland und die Ortlosigkeit seiner Niederlage, gab es hier nun wieder einen Ort, den man benennen konnte. Tataren, Tungusen, Baschkiren, Kosaken und Mongolen des russischen Reichs und die Mamelucken des französischen Empires, zogen neben zehntausenden Österreichern, weiteren Preußen, Schweden, Engländern, Russen und spanischen Regimentern heran. Völkerschlacht. In alter Zeit war Lößnig ein Rittergut mit Wasserburg gewesen. Dieses Gut gehörte jetzt der Familie Kees aus Zöbiker, bei Markleeberg. Auf der Stelle der alten Burgwartei, im Norden des Dorfs, erhob sich nun ihr fürstliches Herrenhaus im Stil sächsischen Spätbarocks, mit schlichtem rechteckigem Grundriss und einem kleinen Garten zur Mühlpleiße hin. Jenseits der Mühlpleiße lagen daran ausgedehnt, die saftigen Weideflächen der Auelandschaft: die Holzwiese, der Anger, die große und die kleine Mühlwiese, dazwischen wieder etwas Wald, das Gautzschholz, und noch weiter im Westen wucherte der Auewald mit seinen sumpfigen Niederungen. Östlich des Herrenhauses gab es die Schäferei mit ihren Ställen und südlich davon, über eine tiefgrüne Schafweide hin, sah man die große Lößniger Mühle, deren Rad unermüdlich durch das Wasser der Mühlpleiße rollte. Zur Mittagsseite lagen auch die reichen Obstgärten, hinter sorgsam herausgeputzen Häusern. Begrenzt wurde das Dörfchen im Osten von der Straße nach Leipzig und im Westen von der Mühlpleiße. Im Norden bildeten die Schafställe und im Süden Dölitz den Abschluss. Das war der Lebenskreis von Anton Weber. Die Dörfer Lößnig, Connewitz und Dölitz waren seine Heimat. Und die Stadt Leipzig, mit seinen Handelsmessen, war für ihn die weite Welt. Ihr Pelz- und Tabakmarkt, ihre Geistesgeschichte und der Reichtum ihrer Straßen gaben Anton Weber oft Gelegenheit, sich an ihrem Dunstkreis satt zu staunen. Von ihr erhielt er das Gefühl trotz allem zur großen Welt zu gehören, wenn er es gewollt haben würde. Von hier aus kehrte er dann gern wieder in seine friedvolle Ruhe ein, sich dem lautlosen Leben hingebend und darin schwelgend, bis das ganze menschliche Gefäß wieder voll Stille war. Dann fühlte er sich auch wieder ruhig genug das Fenster ein bisschen zu öffnen. Die fahrenden Handwerker brachten die neuesten Nachrichten der Schlachten bei Dresden, Bautzen und Lützen, der heftigen Kanonade von Weißenfels oder dem Truppenübergang der Franzosen bei Naumburg über die Saale. Aber schon am 31. April wurden Kosaken im Leipziger Umland gesehen und bereits im Mai kamen „blessierte“ Franzosen von der ersten Schlacht im Südwesten Leipzigs zur Pflege in die Stadt. Und jetzt, im Herbst, trieb das Gewitter immer dichter an die Dörfer heran. Der Aufmarschplan ordnete an: Einkreisung und Entscheidungskampf. Mit auffällig langem Klopfen an der Tür und straffem Rufen französischer Kommandos auf der Straße endete die behagliche Ruhelage des Anton Weber, am 14. Oktober des Jahres 1813. Einquartierungsanweisung der französischen Militäradministration: dem Offizier ist für die Dauer des Kriegszustands, respektive bis auf Abruf, ein Zimmer zur Verfügung zu stellen. Verpflegung erhält jeder Angehörige des Militärs vorerst aus dem Lebensmittelmagazin der Truppe. Ein nervöses Unbehagen wuchs heran, das Anton Weber nun ständig mahnte, nicht hier zu bleiben. Er hatte alle Mühe eine erste dunkle Gedankenwelle davon abzuhalten in diese friedliche Welt einzufallen. Die Vorstellungen davon, was sich noch ereignen könne, hielt er krampfhaft zurück. Er durfte seine Ängste nicht andeuten, nicht aussprechen. Das hieße sie offen herumwandern lassen, in andere Köpfe, wo sie dann selbsttätig herumwilderten und womöglich Wirklichkeit werden würden. Der Offizier blieb freundlich vor seinem Zimmer stehen und dankte dem Zivilisten Weber knapp mit Kopfnicken. Ab jetzt wohnten hier zwei zusammen, die nicht viel an gemeinsamer Sprache hatten. Heftig agitierte man aus dem Untergrund gegen die Besatzer. Deutsche Jakobiner hetzten gegen Jungdeutsche-Nationale, weil die wiederum Quartiere und Munitionslager des französischen Heeres sabotierten. Die Stadt, die gute Handelsergebnisse dank den Franzosen erzielt hatte, erließ Verlautbarungen gegen Aufwiegler, konnte aber nicht viel Wirksames ausrichten. Die Franzosen wiederum, wegen Gerüchten möglicher Überläufer unter den Rheinbundtruppen, misstrauten jedem Deutschen. Und auch unter den mit Frankreich noch verbündeten deutschen Militärs begann, nach den Gefechten bei Dresden, immer mehr Franzosenhass um sich zu greifen. Die Schlacht wurde ein Selbstbefreiungsversuch auch für die geschlagene Volksseele. Anton Weber, der Schäfer, war seine Schafe los, als die Truppe ihr Quartier bezog. Viele Bauern hatten ihre Tiere noch auf entfernte Weiden oder in nahe Wälder getrieben, versteckt, alles andere Nutzvieh wurde requiriert. Schon nach ein paar Tagen bekamen nur noch Angehörige der Garde Lebensmittel aus dem Magazin. Anton Weber war nun nicht mehr als ein Hauswirt für einen franzöischen Offizier. Frauen und Kinder hatten die Dörfer um Leipzig vor Tagen verlassen. Überall lagerten Regimenter in „Biwaks“, Zeltplätze der Soldaten. Eine unendliche Masse aus Menschen streifte übers Land. Hinter jedem Dorf hing eine Landschaft regenverschmutzter, grauweißer Zeltstädte, in denen müde Krieger mürrisch hausten. Anton Weber verschwand, als die Plünderungen so ungehemmt wurden, dass sie auch die Kirchentüren herausbrachen und zum wärmenden Feuer schleppten. Es war bedeutungslos geworden, wie und wo das Holz herausgetrennt wurde. Weil die plündernden Soldaten nicht wie das Vieh auf den Feldern leben wollten, schlugen sie Holz, als wärs ihr täglich Brot. Das Holz der Allee war vom Regen regen nass, aber man riss einen Baum nach dem andern um und zerhackte die prächtigen Kastanien mit vielen Äxten. Auch Treppengeländer, Fensterläden, Zäune, Truhen, Kisten, Möbel, was immer aus Holz war, ging in die Feuer der Biwaks. Tiefschwarz loderten die Feuerwolken in den schmutzigen Herbsthimmel, das Holz war naß, die Stimmung trübsinnig. Kurz bevor Anton Weber, der Flüchtling, verschwand, hatte ihm der Offizier noch die Anweisung gegeben, nach Wachau zu gehen, Meldung zu machen und auf dem Weg umherstreifende Kosaken anzugeben. Zivilisten bekamen jetzt solche Aufträge. Denn kein Franzose sollte mehr den Gefahren eines Hinterhalts oder Verrats durch die Bevölkerung ausgesetzt sein. Anton Weber hatte einen Stempelschein aus Wachau, zum Beweis seiner Ankunft dort, zurückzubringen. Irgendwo an den Lößniger Teichen ließ er die Mission fallen und rannte einfach fort. Die Stille war zerbrochen im Anstimmen der Kriegsgeräte. Selbst in kurzen Momenten der Ruhe war sie doch jede Sekunde bedroht. Anton Weber hatte keine Kontrolle mehr über das, was er zu hören bekam. Kaltschnäuzig platzten die Gewehre ihre Ladung hervor und zerstäubten die Schüsse den Herbst. Anfangs hielt sich Anton Weber fest an den Boden im Unterholz, die Hände am Kopf, bis einer der überall herumstreifenden Kosaken ihn so entdeckte. Zuerst hielt er ihn für einen Toten. Aber war es besser das er ihn lebendig fand? Das Russisch verstand er nicht. Sterben, an dieser so seltsam abstoßend auf ihn wirkenden Klinge, wollte er nicht. Und als dann der Kosak an seiner Kleidung zerrte, ihn hart am Kragen packte und schüttelte bis er die Arme zum Himmel streckte, musste er ihm die Hülle lassen, die er gegen die Kälte nötig hatte. Nur noch mit Unterkleidung bedeckt, die kalten Glieder unnatürlich angespannt, schlich er sich fort zur Stadt, niemandem vertrauend. Bei Connewitz, noch eine Dreiviertelstunde vor Leipzig, setzte der Regen wieder ein. Der kleine Rest an Körperwärme, den er durchs Laufen aufgebaut hatte, schwand schnell dahin. Verzweifelt schrie er nun im Laufen nach irgendeiner Hilfe. Die feuchte und kalte Luft, die er zu atmen hatte, hielt ihn dabei kurz. Alle konnten ihn nun sehen, er war nicht mehr unsichtbar und seine Stille war verraten. Doch, nichts passierte! Obwohl da Menschen waren, ihn sahen, und er sie, veränderte das überhaupt nichts! Schnell hatten sich die Blicke auch an diese Kriegsszene gewöhnt und wandten sich wieder ab. Erst als Anton Weber, der Schäfer, weinend zu Boden ging, und nun so lag, und die Tränen mit dem Regen zusammen auf die kaltvertraute Erde tropften, da kam eine Frau zu ihm herüber, etwas Stoff im Arm. Ein größeres Stück eines alten Vorhangs hielt ihn wieder aufrecht gegen die Kälte. Nur die Stadt blieb im Regen unerreichbar. Als das Gefühl für seine Glieder zurückkam, betrachtete er zum ersten Mal das Streifenmuster des Umhangs, der ihn so kläglich verdeckte mit kurzfristigem Interesse. Die Frau hatte kein Wort zu ihm gesagt. Fliehend davongekommen, ohne Schuhe, ohne menschenwürdige Kleidung und noch weit vor der überfüllten Stadt, setzte er sich, neben anderen flüchtigen Kreaturen, unter einen Schutzverschlag für das vom Regen bedrohte Schießpulver. Das Dorf empfing ihn wie er war und auch die Nacht öffnete sich, am tagelang verschlossenen Himmel. Bis die Dunkelheit eintrat, starrte Anton Weber noch auf die niedergehauene Allee und die Lager, darunter auch eine große Wagenburg, nördlich. Dann verschwand das ausgeplünderte Dorf und Anton Weber begann die Flucht in den Schlaf. Ein Stiefeltritt holte ihn zurück in die Wirklichkeit. Eine Rauchwolke drückte sich dicht über die Dächer, fiel auf die Straße herab, wurde aber von starken Böen bald wieder angehoben. Knackend, knisternd und krachend verglühte hier ein kleiner Bauernhof. Auch das Pulverlager war nicht sicher und Anton Weber musste weiter. Durch die ständig andauernden Sturmböen waren die Bivakbewohner dazu übergegangen, ihre Feuer im Schutz der Häusern zu errichten, und schon allein die Menge der Kämpfer, die hier lagerten, machten solche Ereignisse hochwahrscheinlich. Aus dem Stimmengewirr der Helfer waren deutlich auch Polen heraus zu hören - Poniatowskis Männer. Als A.W. das nächste Mal erwachte, stieg aus dem Dorf nur noch eine feine, weiß und geisterhaft wirkende Rauchsäule. Das Pulverlager hatte überlebt. Das Knarren vorbeiziehender Kanonenwagen stimmte in den Morgen ein und beruhigte auf unheimliche Weise. Ein ganzes Heer schien nun das Dorf zu passieren, wohl um sich zu einem Schwerpunkt der anstehenden Kampfhandlungen zu verschieben. Hin und wieder waren Soldaten gekommen, die über die wundersame Kleidung des Anton Weber lachten; für ihre Augen noch eine willkommene Abwechslung, für die meisten anderen fast eine neue Normalität. Irgendwann hatte er etwas essen und trinken können, seine nackten Füße, wie die Bettler, mit Lumpen umwickelt und so der Kälte entzogen. Auch hatte er einen Platz an einer Feuerstelle gefunden: Überleben auf Zeit. Beobachtungsposten hatten feindliche Kräfte im Gehölz westlich von Connewitz gesichtet, denn es sammelten sich dort nun Schützen am westlichen Dorfrand, und das diesseitige Ufer der Mühlpleiße wurde mit Feldwachen verstärkt und Kanonen zum Wald hin ausgerichtet. Ein paar Scharfschützen und französische Tirailleure bezogen Stellung im Eichengehölz zwischen Mühlgraben und Pleiße. Das kleinlaute Rauschen des Mühlgrabens im Hintergrund, direkt am Westrand, war einer dieser Geräusche, die mit ihrer friedlichen Neutralität die Szenerie harmloser wirken ließen als sie tatsächlich war. Die hohen Hüte der Füssiliere wippten im Lauf. Uniformbändchen, Schnüre oder Fädchen schauckelten stolz und Bajonette strahlten stählern, himmelgrau. Irgendein Wille hielt hier Wacht auch über die Feierlichkeit des Krieges. Mehr Krieg sollte kommen. In Connewitz wurde er gegen Neun wieder eröffnet, mit den Scharfschützen und Kanonen am Westrand des Dorfes. Es war nun der 16. Oktober 1813. Die Österreicher, unter General Graf Meerveldt, mit einem riesigen Schwarzenberger Kontingent im Rücken, machten einen Versuch den rechten Flügel der Franzosen von Leipzig abzuschneiden. Obwohl hier das Gelände durch die gerade hoch stehende Pleiße und ihre steilen Ufer äußerst mühselig zu erobern war, entwickelte sich hier nun für einige Zeit ein heftiger Ansturm. Die Brücken übers Gewässer waren von Franzosen oder Polen abgetragen worden und so ging es überwiegend in den Fernkampf. Die starken Eichen wurden heftig gerupft. Irgendwann gaben auch die Österreicher mit ihren Kanonen Feuer, die sie auf einer nahegelegenen Wiese aufgestellt hatten. Doch ihre Geschosse flogen über die Aufstellungen weg, sausten über die Häuser im Dorf und schlugen dann spät in die Biwaks der Feinde. Irgendwann bemerkten einige Polen, dass die Österreicher nicht mehr feuerten. Schon lange stieg kein Nebel mehr aus dem Unterholz. Nachdem nun auch diesseits des Ufers das Schießen langsam endete, glich die Ruhe einer Totenstille. Genau an diesem Punkt begann plötzlich ein Sturm österreichischer Infanterie über den Fluss! Und im nächsten Moment schossen die Österreicher wieder aus allen Rohren! Franzosen und Polen wichen irritiert nach hinten aus. Schon standen die ersten Österreicher am Connewitzer Uferabschnitt. Pioniere hatten einen Hilfssteg gebaut, über den nun ein Großteil der Feinde strömte. Plötzlich schrie einer: Le general! Le general! Und immer wieder erklang der wilde Schrei. Da wendete sich die Situation. Aus den zurückweichenden Polen wurden wilde Krieger. Einer der Franzosen hatte den General Graf Meerveldt entdeckt, der mit einem Pferd und geringer Begleitung gleichfalls über den Fluss gesetzt war. Jeder Pole verstand dieses einfache Signal und es begann eine Jagd, vorallem auf ihn. Außerdem waren die Jäger so geschickt, ihn zunächst von einem Großteil seiner Truppe zu trennen. Dann zogen sie sich immer enger um ihn und seine kleine Kürassierordonanz zusammen. Eben wollte er sein Pferd zur Flucht - zurück über den Fluss - wenden, als das von einer Kugel getroffen, stolpernd auf die Knie sank. Treu versuchte es sich, in einem Überlebenskampf für seinen Herrn, aufzurichten. Immer wieder spannte es die starken Muskeln. Immer wieder brach der Schmerz den stolzen Lauf. Ein letzter Schuss entschied das Schicksal. Meerveldt wurde gefangen. Anton Weber hatte sich aufgerichtet als die Österreicher das Ufer stürmten. Selbst machtlos, wollte er versuchen zumindest den Überblick zu behalten. Ohne irgendeine Form der Bewaffnung, begann er sich zu fragen, für wen er sich im Kampf überhaupt entscheiden solle. Er musste an den Kosaken mit seiner Kleidung denken, den französischen Offizier in seinem Haus, die vielen fremden Gesichter, ihre fremden Sprachen, die fliegenden Kanonenkugeln der Österreicher. Wie ein großes Rätsel erschien ihm diese Frage und verwirrte ihn. Vielleicht sollte er versuchen weiterzuziehen? Dann hätte er vielleicht weniger Probleme mit einer Entscheidung. Und so sah man Anton Weber, den Schäfer im Krieg, eine Stunde später über die Felder nach Osten, weg vom Dorf, weg von der Stadt gehen. |
| Krieg und Meister Boden der Völkerschlacht. Leipzig im Herbst. Die französisch geführten Polen verteidigten die Stellungen in Dölitz gegen die Österreicher, mit den Regimentern des Landgrafen von Hessen-Homburg und des Grafen Merveldt. Ich entließ die Geister der Gegenwart. Ich schloss meine Augen. Es war immer noch Herbst. Ich fand mich im Nebel von tausend Gewehrsalven und hörte den Donner der Kanonaden. Ich war mitten in der Schlacht und der Himmel war unförmig von der Sonne getrennt. Ein Soldat lief an mir vorüber, sein Gewehr noch nicht abgeschossen, rückte er vorwärts. Ich sah weitere Soldaten, mit grauem Gemüt, jeder für sich seine Bahn ziehend. Ich sah einen wilden Reiter, mit dem Blick eines Blutsüchtigen. Der brach herein mit dem Krieg, über den Krieg, wie ein heftiges Gewitter. Ich belagerte ihn mit Blicken. Als er mich dabei bemerkte, stürmte er heran, lachte auf mich herab und fragte, ob ich auch ein Teufel werden wolle. Die drei Kilometer vom Lager nördlich von Cröbern, an Raschwitz vorbei, bis hier nach Dölitz hatten die meisten der 50.000 Österreicher der 1. Kolonne unter Hessen-Homburg an diesem 18. Oktober bis 8 Uhr schon hinter sich gebracht. Ab 2 Uhr in der Nacht hatten sich die französischen Linien weiter zur Stadt hin zurückgezogen und blieben eine Fußstunde von ihr entfernt für das nächste Treffen liegen. Dölitz fiel, mit all seinen Opfern, von einer Hand in die andere. Ich saß auf der kleinen Insel, im alten Burghof vor dem Dölitzer Schloss. Der Mühlgraben, der das kleine Gelände umarmte, rauschte unerkannt unter dem Getöse der Waffen hinweg. Mir war kalt und die Luft um mich her war vom abgebrannten Pulver durchsättigt. Der weiße Nebel lagerte immer dichter um den Platz. Das Abendgrauen wartete noch hinter der sumpfigen Niederung im Westen. Keines Vogels Lied störte mehr den Gesang des Krieges. Ich sah den verwilderten Reiter, von einer Blutjagd kommend. Um ihn erglänzte zwielichtig, verwegenes Heldentum. Józef Antoni Poniatowski schlug sich schon mit den Türken in Šabac, bevor er zum maréchal de France wurde. Poniatowski´s Bein wurde dabei schwer am Oberschenkel verwundet. Vor einem Jahr und einem Monat hatte er mit Napoleon zwei Tage lang in Moskau gestanden, dann, über Polen nach Leipzig ziehend, in Krakau 16000 Polen angeworben und durch Böhmen und Mähren hierher geführt. Feindliche Angebote zur Allianz überzulaufen, schlug er aus. Polen wurde von Frankreich zum Teil begünstigt. So kämpfte der Fürst mit seinem 8. Armeekorps im rechten Flügel südlich von Napoleons Leipzig, mit dessen Verlust nämlich auch Polens Ansprüche verloren wären. Die Erde erbebte unter unserem Ansturm. Wir rasten auf dem Rücken von Pferden wie Söhne der Hölle über ein von der Sonne verlassenes Schlachtfeld. Wir schossen alle Karabiner leer und hieben mit den Säbeln in das Fleisch unserer Gegner. Unsere Glieder lebten im Auftrag der eiligen Klingen. Ihre reine und ungehinderte Bewegung war Zweck und Ziel aller Kraft. Bis der Tag zuende ging, wilderten wir in den Reihen des Gegners. Das grimmige Gesicht des grausigen Reiters flog an mir vorüber. Ich sah, wie er in die gegnerischen Reihen haute, der gewaltige Töter mit den eisernen Händen. Immer sorgte sein Ross wie ein dämonischer Begleiter wieder für sein Entkommen. Dieser Montag wurde mit sehr viel Blut in den Schlachtboden geschrieben und kein Zuchtmeister konnte uns tollgewordene Hunde halten, wenn wir uns mit heiligen Worten zum Kampf riefen. Unhaltbar zog uns der wilde Reiter hinter sich her und immer weiter auf den blutigen Pfad der Raserei. Ich versuchte zu erfahren, wer diese dämonische Gestalt war. Doch blieb er ein namenloses Wesen. Erst unsere Erschöpfung ließ auch ihn weniger rasen. Aber nun hatten wir schon keinen Blick mehr auf ihn und versuchten uns ins Lager zurückzuziehen. Was unsere Gegner unseren Leibern gleichsam zur Veredelung zugefügt hatten, das begann erst jetzt unsere Aufmerksamkeit zu plagen. Die ganz üblen Striche hatten einige ohne Verzögerung auf dem Blutfeld gerichtet und sie kehrten nicht wieder. Die Nacht hatte sich der müden Knochen erbarmt und verhüllte Freund und Feind mitleidig in ihrer Lichtlosigkeit. Seit Tagen hatte der Regen aus dem Untergrund eine Schlammlandschaft geformt und setzte sein Wasserspiel fort. In der Nacht auf den 15. Oktober hatte sich sogar ein starker Herbststurm kräftig in den Ortschaften ausgetobt. Wachposten beseelten das umherstehende Mauerwerk. Die Kampfpause vom Sonntag, hier im Süden, war bereits eine lang zurückliegende Erinnerung. Der lockende Eindruck des kleinen Friedens wurde an diesem Tag vom Contremarche und den Sturmtruppen über den Haufen geschossen. Die Nacht weckte Bilder meines Gewissens. Ich verlor die Hausmacht über meine innere Rechtssprechung. Als ich vom Schweiß durchnässt erwachte, war ich bereits auf der Flucht vor meinen Erinnerungen. Welche dunklen Mächte hatten meine Grausamkeit so groß werden lassen? Oder entdeckte die Grausamkeit mich, oder erkannte sie mich wieder, wie sie mich schon manchmal im Leben mit unheilvoller Geste begleitet hatte, dann aber wieder verlor, an die Liebe und die Schönheit? Die Nacht war immer noch da. Ich war immer noch da, aber ein Fieber hatte sich eingestellt. Ein Blick an mir herunter, und über die vielen Verbände an mir, erzählte mir von den vielen Gelegenheiten des Feindes einen Einfall zu wagen. Der Krankenbericht, den ich mir selbst gab, war beunruhigend und ich starrte zur Ablenkung auf die alte Mühle, welche wir als Stellung auch verloren hatten. Ihre Arme ragten bewegungslos gegen den Nachthimmel, so als hielten sie sich nur noch zur Klage, mit zerzausten Gliedern, gerade. Die Nacht und das Fieber hatten begonnen ihre Schrecken auszusenden. Ich sah, wo eben noch die Wachposten gestanden hatten, den wilden Reiter auf Patrouille reiten. Doch von seinem Gesicht sah man nur die Narben, einen starr lächelnden Mund und die wilden Augen hervorblitzen. Ein Rabe kam heran, setzte sich auf seine rechte Schulter und hackte von dort, mit kurzen Pausen, auf den Brustpanzer des grausigen Kürassiers. Eine übriggebliebene, noch nicht zu Kanonenkugeln eingeschmolzene Turmuhr schlug die erste halbe Stunde des neuen Tages an. Beim zweiten Blick auf den Reiter hatte der Rabe schon ein faustgroßes Loch gehackt. Der Reiter griff mitten hinein und zog einen neuen und blanken Säbel hervor. Dann fasste er nach seinem Unterschenkel, zog ihn ab, als wärs ein Bündel Gras, und hielt ihn am Fußgelenk in seiner anderen Hand. Im nächsten Augenblick wurde das frische Bein zu Knochen. Damit zielte er auf mich, wie mit einer Reiterpistole, lachte und schoss. Der allgemeine Rückzugsbefehl vom späten Abend war eine Wirklichkeit, die unser ganzes Korps über Nacht in Bewegung setzte. Es schlug zur zweiten Nachtstunde. Jetzt sollten wir nach Leipzig hinein und dort der, sich über das Ranstädter Tor nach Weißenfels und weiter nach Westen, zurückziehenden Großen Armee den Rücken decken und Vorsprung verschaffen. In der Stadt hatte der Typhus seine Tore weit geöffnet. Ich selbst brachte der Stadt keinen guten Anblick. Gestern noch Krieger, war ich doch schon besiegt und bis zur Stunde ein wehrloser Zuschauer geworden. Nach 7 Uhr besetzten die Österreicher Dölitz endgültig und plünderten die Reste aus. In den Straßen und Gassen, an die Häuser gelehnt, in Kirchen und auf Plätzen, überall verteilt, war das Heer der Kriegsopfer, in allen erdenklichen Zuständen. Der zerlumpte Chor der menschlichen Ruinen weckte hier kaum noch Mitleid. Damit die Ratten und Vögel nicht an die Leichen in den eilig ausgehobenen Gräbern gingen und die Flamme der Seuche nicht noch heftiger aufloderte, wurde eine Kalkschicht darüber verschüttet. Es war kein Schlaf ohne Schrecken und Müdigkeit überall. Der Tag war nicht gnädig und die Nacht schrecklich geworden. Den Sternenmantel hatte sie ausgezogen. Nun trug sie den Feuerschein und den Rauch der langsam verbrennenden Dörfer über den Himmel ins Land hinaus. Ihr leisewiegender Schritt, ihr silberner Gang durch die Straßen der Stadt, war nun ein unheimlicher Singsang kläglicher Rufe, verfolgt von einem Schrei, Poltern, Klirren. Ein Holzbein wurde über das Pflaster gezogen. Unwillig klapperte es einen greulichen Takt und irgendwo zwischen zwei Häusern verscholl das Geräusch wieder. Das war die Nacht geworden und ihre Bilder wucherten weit in die Seele hinein. Poniatowski, der sich am Sonntag in Lößnig und Dölitz noch redlich um Bürger und Soldaten gekümmert hatte, wurde mit dem Oberbefehl über die Nachhut betraut. Als der Rückweg über die Elster unter Beschuss geriet, wurde die für den Rückzug verbliebene Brücke, aus Panik von den eigenen Leuten viel zu früh gesprengt. Poniatowski, mehrfach getroffen, versuchte mit seinem Pferd an anderer Stelle überzusetzen, doch ertrank, schon geschwächt, in den Fluten. Fischer fanden ihn zwei Tage später. Auf seinem Leichengang bekam er alle Ehren und wurde zurück nach Warschau gebracht. Am Peterstor schlug ein Ross wild mit den Hufen. Ein alliierter Kürassier ließ ein unheilvolles Lachen auf die Stadt herabstürzen. Er zog eine Pistole aus dem Stiefelschaft und schoss ein großes schwarzes Loch in den Himmel. |
| Donnerdämmerung Rechts der Pleiße stand eine Anhöhe voller Kanonen in der Morgendämmerung. Kanoniere stapelten Eisenkugeln mit großer Sorgfalt auf kleine Häufchen. Am Horizont streckten sich die Türme Leipzigs, müde und schwer, zum Himmel, und ein paar Zinkbecher klapperten an den Wachtfeuern. Kein Bauer brachte mehr Korn ein. Nur der niemalsmüde Schnitter, der Tod, sollte nochmal aufs Feld. Die von den letzten Tagen angestauten Vorräte waren noch nicht ganz verdaut. Bald aber würde er wieder mitten reinschneiden. So lag nun des Heeres Ruhe im Anschlag vor stillen Schlachtfeldern und der Schnitter bekam sein Erntedankfest, denn es war der Morgen des 18. Oktober 1813 im Südraum vor Leipzig. Schlag Acht schrie´s durch die Reihen: „Schütze reinfeuern! Schütze eins beginnt! Geschütze … Feuer!“ Und dann begann das Feuerwerk des 18. Oktobers, grausig grollend, am Rad der Geschichte zu drehen. Der Schnitter lief, und der Herbst ließ seine Blätter dazu fallen. Der weiße Atem der Kanonen verhüllte weich den Hügel, darin Schwarzpulveratmen. Nur die Flammenspitzen züngelten durch das Meer der Feuerwolken, und der Lärm rollte auf unbestimmte Zeit nach. Das Finale hatte begonnen. Alles wurde dem Feind entgegen gewurfen. Überall blieben deutliche Spuren zurück: in den Formationen – die Schneisen, in den Tälern - der Rauch, in den Ohren - der Lärm. Nichts blieb unberührt. Alles wiegte sich im Sturm der Geschichte. Auch Béla S. hatte seine Hand mit an diesem Rad der Geschichte. Da es zurückgedreht werden sollte, d.h. Europa von Napoelon befreit, machte das einen Höllenlärm und brauchte viele Helfer. Béla bewegte dazu eine österreichische Kanone. Nach dem Verdämmen der Ladung, brachte er mit leichtem Bogenschuss die Achsen in Bewegung. Es waren viele kleine Rädchen, die alle mitgehen mussten und Béla war ein Genie der Bewegung. Geboren als Ungar, Alliierter Oberkanonier, perfektionistisch, ohne Frau und Gewissen, und dazu ein wenig lauffaul, so war er. In Hinsicht auf seinen beruflichen Perfektionismus war er ein Ideal. Sein feiner Sinn für alles Bewegliche, ließen ihn eine exakte Bahn für den Kugelflug kalkulieren und das kleinste Ziel abservieren. Begonnen hatte er seine Laufbahn hinter den Kanonen, auf schwankenden Planken einer englischen Windjammer, die damals, irgendwo zwischen dem Kap Hoorn, New-England und dem Port of London, den Atlantik kreuzte. Von dort hatte er ein windschnittiges Holzbein mitgebracht. In Triest ging er, von einem schwarzäugigem Mädchen angelockt, an Land, und kam über die Landsmannschaften Friauls zum Österreichischen Heer. Jetzt sang der „schwarzhändige Béla“ widersinnig Seemannslieder in die Schlacht. Und immer wenn er sein garstiges Pulver vermischte, kam noch der Gestank des Schwefels und feiner Holzkohlenruß dazu, sodass jeder sich wunderte, der den österreichischen Artilleristen zum ersten Mal bei der Arbeit zu sehen bekam. Bélas Gesicht war eine Landkarte seiner Unternehmungen geworden. Kaum zwei Zentimeter davon waren ohne Zeichen und Markierungen geblieben. Für die lange und breite Narbe, quer über Nase und Wange, hatte er beinahe auf sein rechtes Auge verzichten müssen. Schon die Vielseitigkeit der Narben verwirrte den Betrachter. Brandnarben und Schnitte, Wundnarben und sogar eine Schussnarbe zogen hier die Bilanz einer Lebensbahn mit schweren Hindernissen. Nur wenn man ein paar Minuten Zeit hatte für dieses Gesicht, lernte man damit umzugehen. Doch selbst ein entstelltes Gesicht wie das Bélas, konnte manchmal noch Lächeln. Und dann zuckte es in vielen kleinen Fältchen und spannten sich genüsslich frohe Falten und diese ruppige Leinwand wurde zu einem beeindruckenden Portrait eines weit gereisten Lebens. Béla, der lauffaule Oberkanonier, feierte heute allerdings ein merkwürdiges Montagsfest. Ausgelassen verschoss er eine Kugel nach der andern, als gälte es, sie unter gute Freunde auszuteilen. Dabei schnorrte er die verruchten Moritaten längst toter Galeerenhäftlinge, lachte bei jedem Abschuss einmal laut dem Eisenrund hinterher, und machte sich dann wieder hinter seiner Kanone zu schaffen. Zwei tollkühne Raben kreisten über der Nebelbank. Darunter verschmolz das Kanonenspiel, durch unerschöpfliche Menge, zu einem einzigen stehenden Brüllen von Abschüssen. Rastlos und wie ohne Bedeutung, vergingen die Spuren menschlicher Ansiedlungen. Alles zerstob unter den tausend Einschlägen des Kriegsgewitters. Wand um Wand, Mauer um Mauer zerriss im kurzen Chaos ankommender Geschosse. Bélas einsames Lachen war längst verstummt. Um ihn herum waren die meisten Geschützstellungen verwüstet, doch das schwankende Glück ließ ihn stehen. Verwundete, die zum Teil nach Stunden endlich weggebracht werden konnten, klagten über ihr zerrissenes Fleisch. Mit den noch erhaltenen Händen hielten sie ängstlich ihre lock´ren Glieder. Die abgetrennten Gliedmaßen lagen leblos und verbraucht auf zerwühlten Feldern aus. Für jeden gebrochenen Körper gab es bald schonwieder Edelmetall an die Brust. Béla, auf seiner Anhöhe, nachdem er die letzte Kugel auf das völlig entseelte Dorf verschossen hatte, senkte sich herab und ging mitten hinein, in die gerade von ihm veränderte Welt. Neugierig auf das, was er geformt hatte, ging er, Béla, der lauffaule Genius der Bewegung. Lief zu dem Punkt, der sich noch immer im Schleier verbarg. Es war die vollendete Ödnis. Kleine Blutströme hatte er zu kreuzen, der Weltensegler. Zerklüftete Tierkadaver reckten mutlos ihre Knochen, wie Gebirge, um die zögernd Raben hüpften. Kein Lied war auf den Lippen der Sterbenden. Kein Heldenlied auf Bélas Zunge, nur der Geschmack für Pulver und Rauch. Rauch auch aus offenen Fenstern, offenen Dächern. Rauch aus der Ferne, aus der Werkzeugkammer des Donnergotts. Rauch der jungen Schöpfung und eine Landschaft, geformt aus Hitze und Kraft. Eine Welt wie aus Feuer geboren. Sein Eisenerz war stärker gewesen als die steinernen Zufluchten seiner Feinde und zu seinen Füßen lag das Dorf nun, zerschmettert und frei. Ein Land der Schmerzen bog sich glimmend über die Hügelketten. Er betrat es neugierig und still. Noch nie hatte er etwas so schrecklich Großes vollbracht. Doch diese Ödnis wollte nichts mehr. Hier wollten sich nur noch letzte Reste entleeren. All ihr Jammer wuchs in sein Herz. Aber war es denn nicht gut gemacht? Jeder wollte doch etwas können, dachte er bei sich. Und das hier war es doch, was ihn vor allen anderen auszeichnete, warum er hier war, vielleicht sogar warum er überhaupt war. Er war doch der eiserne Steuermann am Geschichtsrad, der Kugellenker. Und er stellte sich stolz vor sich selbst: Er war einer der Schicksalsschmiede, die Hand mit am Schmelztiegel und seine Hammerschläge trafen gut. Er war ein Befreier! Selbst die Franzosen sahen es nach Jahren der Besatzung so. Und auch wenn die Sonne jetzt unterging, über diesen Überresten, es war doch nicht der allerletzte Tag. Es würde doch sicher wieder ein Haus gebaut, gleich hier. Es konnte doch alles neu werden. So neu wie dieses war. Das hier war doch nichts! Es war nicht mehr als eine Schicksalsnarbe, nur Bilder der Erinnerung. Und er hob einen Stein auf und legte ihn auf einen andern und noch einen nahm er und legte ihn oben auf, und immer so fort, für einen ersten Haufen. Er begann die ersten Steine zu stapeln, wie heute Morgen noch Eisenkugeln gestapelt wurden. Er sammelte und häufte, je mehr desto hastiger. Er wollte einen Anfang machen. Er wollte zeigen, dass hier nichts verloren war, aber die Ödnis lachte über ihn und der Schweiß trat ihm auf die Seefahrerstirn. „Das ist mein Land! Ich habe es gewonnen!“, schrie er schrecklich, und die Steine kletterten zum Himmel hinauf. Doch es wollte nichts halten. Alles lag lose umher oder aufeinander, unverbunden, Bruchstücke. Da fügte sich nichts zu einer Mauer zusammen. Lustloses Übereinanderliegen war es. Was es auch war, es war alles Eins geworden: ein zerstoßener sinnloser Stoff, und was immer es vorher gewesen sein mochte, jetzt war es nur ein zerrissenes Dorf, über dem die Sonne unterging. Hatte Béla vorher noch um die Eroberung eines Dorfes gekämpft, kämpfte er nun um die Zukunft vor seinem Gewissen, gegen die höhnende Ödnis. Ihre Zurschaustellung nichtswertiger Leere und maßloser Trostlosigkeit, ihr obszönes Prahlen mit Trümmern und Toten, erzürnte ihn, während Jammer und Qual von ihr ab, zu ihm übergingen, je länger – je mehr und aus der Ödnis wurde ein lebloses Inferno. Von alldem übermächtigt, sah er sich um und die Gegenwart so vieler Toter, machte ihn immer anfälliger, bis er sich selbst auch nur noch als flüchtigen Menschen sehen konnte, ein Hauch von Leben, ohne wirklichen Schutz und bestimmt zum Tod auf Zeit. Da zündete mit lautem Knall noch eine herumliegende Waffe. Gnadenlos brach sie die herbeigesehnte Stille. Unter eines Augenschlags Dauer, mit nur einem Schuss, zerriss sie das seidene Band, das Béla den Herrn seiner Schöpfung sein ließ. Und die schreckliche Ödnis raubte Bélas Geist. Béla, der eisenbewegende Genius, war vergangen. Mal saß der zitternde Körper auf einem Trümmerberg, mal zog er mit seinem echten- und seinem falschen Bein über die Hügel fort, um bald verängstigt wieder zurück zu kehren. Und niemand der vorüber kam, erkannte ihn wieder. So begann der „schwarzhändige Béla“, langsam zu verlieren, was er alles gewonnen hatte. Bis tief in die Nacht hinein wurde heute noch an anderen Stellen nachgeschossen. Das Rad hatte sich endlich bewegt. Die Welt war wieder unter alten Zeptern. ... geschrieben 200 Jahre nach der Schlacht - 2013 |